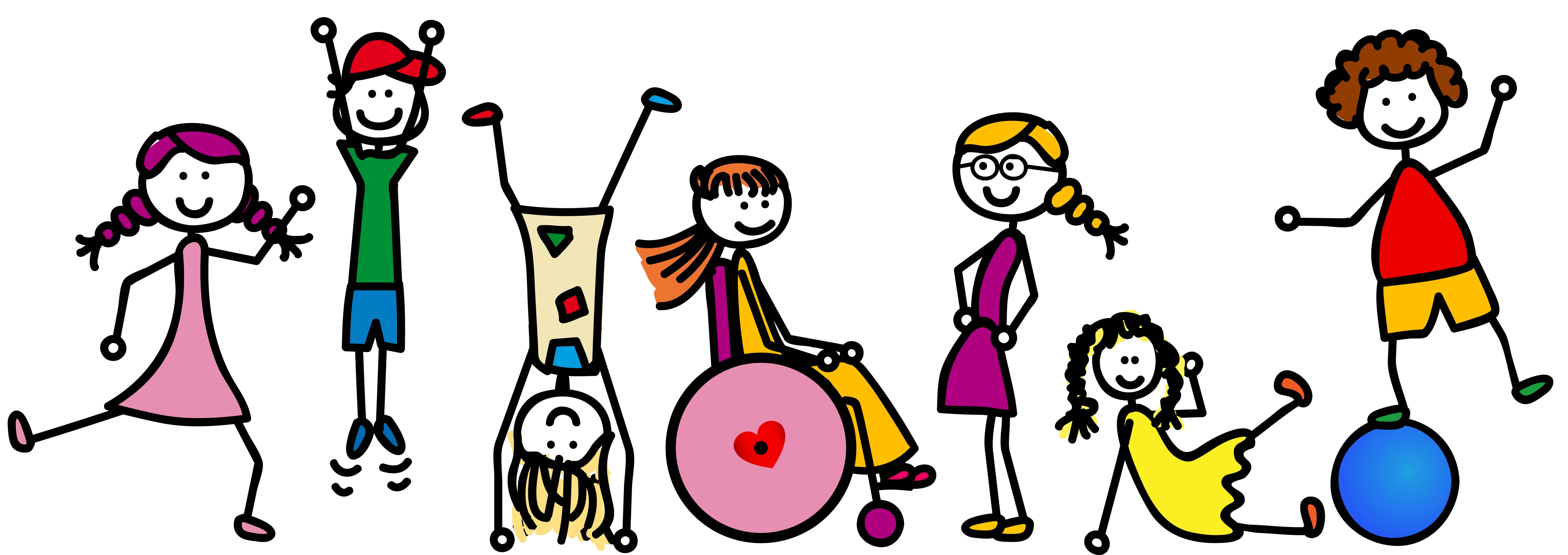
Spielen – Motor für Entwicklung und Gemeinschaft
Die Spielen ist weit mehr als ein Zeitvertreib: Es ist ein zentraler Motor der kindlichen Entwicklung. Im Spiel entdecken Kinder die Welt, erproben Fähigkeiten und lernen, mit sich und anderen umzugehen. Sie lernen, Probleme zu lösen, kreativ zu denken und mit Gefühlen wie Erfolg oder Frustration umzugehen.
Gleichzeitig ist Spielen ein soziales Lernfeld, in dem Kinder Regeln aushandeln, Rücksicht nehmen und Gemeinschaft erleben – unabhängig von Behinderung, Herkunft oder sonstigen Merkmalen. Pädagogisch gilt es als wichtigste Lernform, weil es Neugier, Empathie und Zusammenarbeit fördert und so den Grundstein für persönliches Wachstum und gesellschaftliches Miteinander legt.
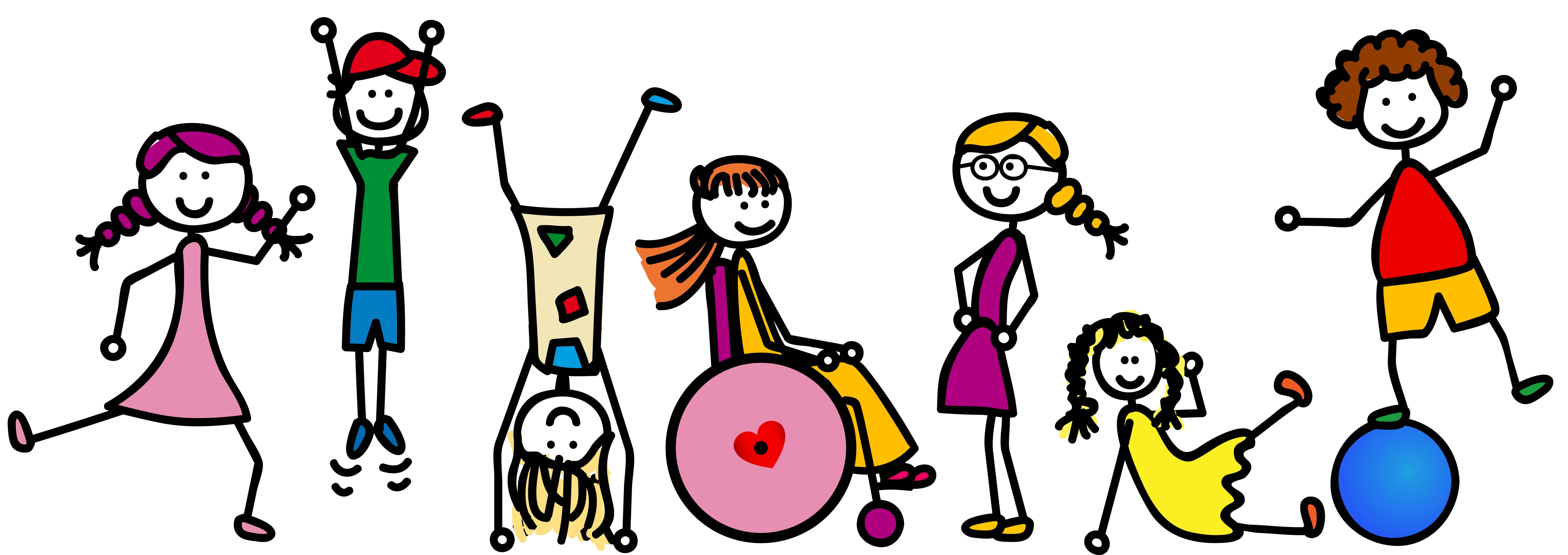
Von der Beeinträchtigung zur Behinderung: Ein persönlicher Einblick
Im Alltag begegnen mir die Themen Beeinträchtigung und Behinderung ganz persönlich. Unsere Tochter hat Achondroplasie, eine von über 650 Kleinwuchsformen. Sie ist klug, selbstbewusst und eigenständig. Und doch stossen wir immer wieder auf Barrieren, die ihr das Leben unnötig erschweren. Diese Hindernisse machen ihre Beeinträchtigung erst zu einer Behinderung.
Die UN-Behindertenrechtskonvention definiert den Begriff „Behinderung“ genau so: Menschen gelten als behindert, „wenn langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen sie in Wechselwirkung mit Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“.
- Eine Beeinträchtigung beschreibt also die körperliche oder geistige Einschränkung, etwa eingeschränktes Hörvermögen.
- Eine Behinderung entsteht erst durch äussere Barrieren, welche die Teilhabe verhindern.
Oft wird versucht, das Wort „Behinderung“ zu vermeiden, vielleicht aus Hemmungen, die Dinge beim Namen zu nennen. Hinzu kommt, dass der Begriff leider noch zu oft als Schimpfwort verwendet wird. So entstehen Ausweichbegriffe wie „Menschen mit Handicap“ oder „mit besonderen Bedürfnissen“. Doch diese Umschreibungen treffen den Kern nicht: Es sind Menschen mit einer Beeinträchtigung, die durch gesellschaftliche Barrieren behindert werden, vollständig teilzuhaben.

Der entscheidende Unterschied: Barrierefrei vs. Inklusiv
Um echte Teilhabe zu schaffen, müssen wir zwei Begriffe klar unterscheiden:
Barrierefreiheit
- Definition: Barrierefreiheit bedeutet, dass Orte, Informationen und Produkte so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen ohne zusätzliche Hilfe genutzt werden können.
- Ziel: Hindernisse abbauen, damit alle Zugang haben.
- Beispiel: Ein Spielplatz hat befestigte Wege und die Spielgeräte sind mit einem Rollstuhl erreichbar.
Inklusion
- Definition: Inklusion bedeutet, dass alle Menschen – unabhängig von Behinderung, Herkunft, Alter usw. – gleichberechtigt und selbstverständlich an allen gesellschaftlichen Bereichen teilhaben können.
- Ziel: Eine Gesellschaft, in der Vielfalt normal ist und niemand ausgeschlossen wird.
- Beispiel: Ein Spieltisch in passender Höhe ermöglicht, dass Kinder im Rollstuhl und stehende Kinder gemeinsam im Sand bauen.
Merksatz: Barrierefreiheit ist die Voraussetzung – Inklusion ist das Ziel.
Barrierefreiheit schafft Zugang, Inklusion schafft Teilhabe.
Inklusion ist ein Gewinn für alle
Inklusion bedeutet nicht, dass Spielplätze nur für Kinder mit Behinderung zugänglich gemacht werden. Es geht darum, dass alle Kinder gemeinsam spielen können, und zwar unabhängig von ihren Fähigkeiten, ihrer Herkunft oder ihren Bedürfnissen.
Wenn ein Spielplatz inklusiv gestaltet ist, profitieren alle davon.
Kinder lernen dabei nicht nur voneinander, sondern miteinander. Sie erleben Vielfalt als etwas Selbstverständliches. Das Kind im Rollstuhl zeigt, wie man kreativ Wege findet, eine Rampe zu nutzen, das sehende Kind beschreibt begeistert, wie hoch es klettert, und das zurückhaltende Kind fühlt sich willkommen, weil es auch ruhigere Spielbereiche gibt.
So entsteht ein Raum, in dem Unterschiede keine Hindernisse sind, sondern Teil einer bunten Gemeinschaft.
Auch sozial betrachtet ist Inklusion ein unschätzbarer Gewinn. Kinder können früh Empathie, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft entwickeln – Werte, die weit über den Spielplatz hinausreichen. Gleichzeitig wird das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt, weil sie merken: „Hier ist mein Platz, so wie ich bin“.
Fazit: Wenn alle mitspielen dürfen, spielt die Zukunft mit
Ein inklusiver Spielplatz schafft mehr als nur Bewegungsfreiheit; er fördert soziale Kompetenzen, Toleranz und Zusammenhalt.
- Spielplätze sind keine Orte für einige, sondern für alle Kinder.
- Sie sind ein Schlüssel zu echter Teilhabe.
- Inklusive Spielplätze sind kein „Luxus“, sondern ein Recht.
Spielen ist der erste Schritt in die Gesellschaft, und inklusive Spielplätze zeigen, dass diese Gesellschaft für alle offen sein kann.
****
Über die Autorin

Yvonne Bindbeutel widmet sich seit über 10 Jahren der Inklusion und Teilhabe von Kindern auf Spielplätzen. Für die Landschaftsarchitektin (B.Eng.) und Qualifizierte Spielplatzfachkraft steht das barrierefreie, gemeinsame Spielen aller Kinder im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie verfügt über umfassende praktische Erfahrung als Projektleiterin für Spiel- und Freizeitanlagen bei verschiedenen Städten sowie Institutionen. Mit ihrem Unternehmen Spielklusion begleitet sie Kunden von der Idee bis zur Eröffnung. Seit 2024 ist sie zudem im Vorstand des SVSS (Schweizerische Vereinigung für die Sicherheit von Spiel- und Freizeitanlagen) tätig.




